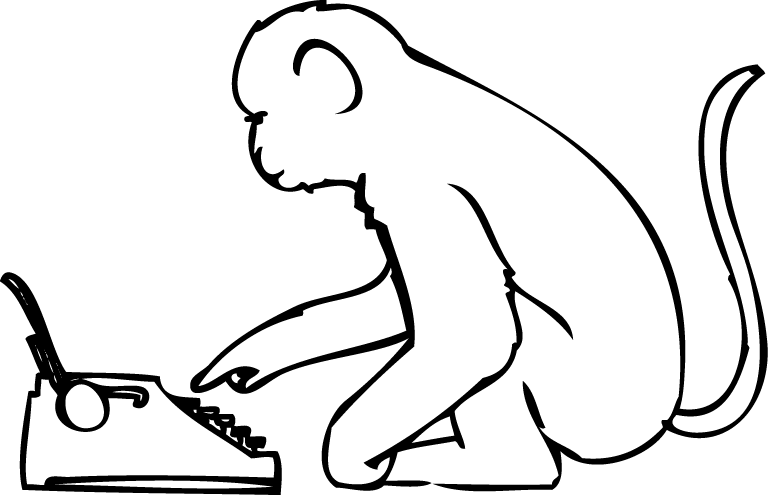Da steht sie vor mir auf dem Tisch: Noch gehüllt in der schmutzigen und verstaubten Kunststofffolie, die für die zahlreichen schwarzen Flecken auf meinen Händen verantwortlich ist, und nur darauf wartend, von mir ausgepackt zu werden. Langsam hebt sich die Hülle und Licht strahlt auf die alten Typenhebeln und die wackligen Tasten der Schreibmaschine. Gekauft habe ich sie für 15 Euro, nicht viel zu verlieren, falls sie sich doch eher als Dekorationsobjekt anstatt eines funktionierenden Schreibgeräts entpuppen sollte.

Um es kurz zu machen: Sie funktionierte besser als erwartet. Zwar verkeilten sich die Typenhebel alle paar Sekunden, einige Tasten blieben hängen und nicht immer wurden die Buchstaben auf das Farbband gedruckt. Für ein großes Romanprojekt dann eher doch ungeeignet. Ein paar Seiten habe ich mich durchgekämpft, ehe ich dann wieder auf den vertrauten Laptop umgestiegen bin.
Warum viele andere Autoren trotz des technischen Fortschritts aber noch immer die altbekannte Schreibmaschine vorziehen, dafür gibt es mehrere Gründe:
1. Fokus
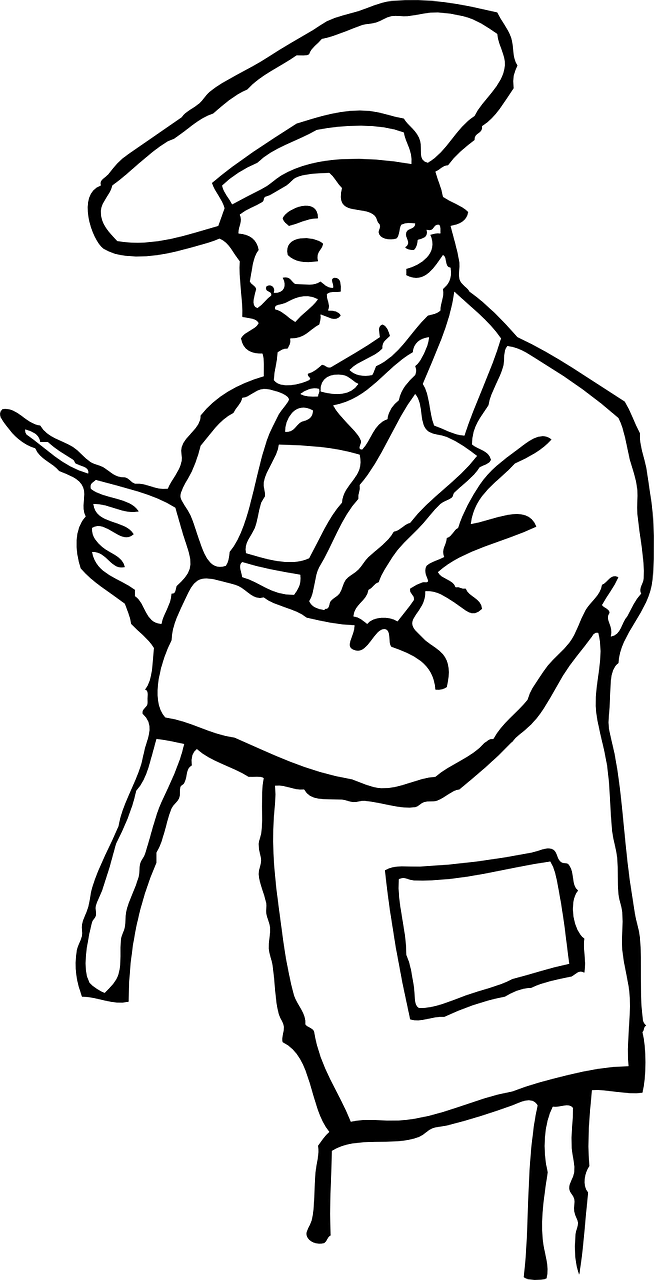
Ein Buch zu schreiben bedeutet in erster Linie volle Konzentration auf den Text. Da wirkt es verlockend, bei einer kleinen Schreibblockade sofort die E-Mails zu überprüfen, Videos zu schauen oder sich anderweitig abzulenken. Oder man wird von plötzlich aufblitzenden Benachrichtigungen gestört und so gänzlich aus dem Konzept geworfen.
Der Vorteil einer Schreibmaschine: Zwischen dem Geschriebenen und dem Schreibenden liegen nur die Tasten. Dies reduziert das Ganze auf das Wesentliche, um das es ja eigentlich geht: Den Text. Und noch viel besser: Man kann den Text auch besser fühlen, denn er ist ja wirklich da, Schwarz auf Weiß.
2. Überflüssiges fällt weg

Wer auf dem Laptop oder Computer schreibt, neigt oft dazu, bestimmte Situationen besonders überschwänglich und unnötig aufgebläht zu beschreiben, was bei der Schreibmaschine nur selten vorkommen sollte. So ist das, was man geschrieben hat, nun mal da. Das Gerät zwingt einen dazu, sich genau mit dem Text zu befassen und sich akribisch exakt zu überlegen, was man denn nun wirklich schreiben will.
3. Der Charme

Es hat schon etwas Besonderes an sich, dieses antiquierte Gerät: Man kennt sie aus alten Filmen, ihre Erfindung hat das schnelle Anfertigen von Texten revolutioniert. Auch wenn mein eigenes Exemplar durch den Zahn der Zeit nicht mehr allzu nützlich ist, so bleibt sie dennoch in meinem Schreibraum stehen — ein schöner Anblick und eine Quelle der Inspiration.
4. Immer einsatzbereit
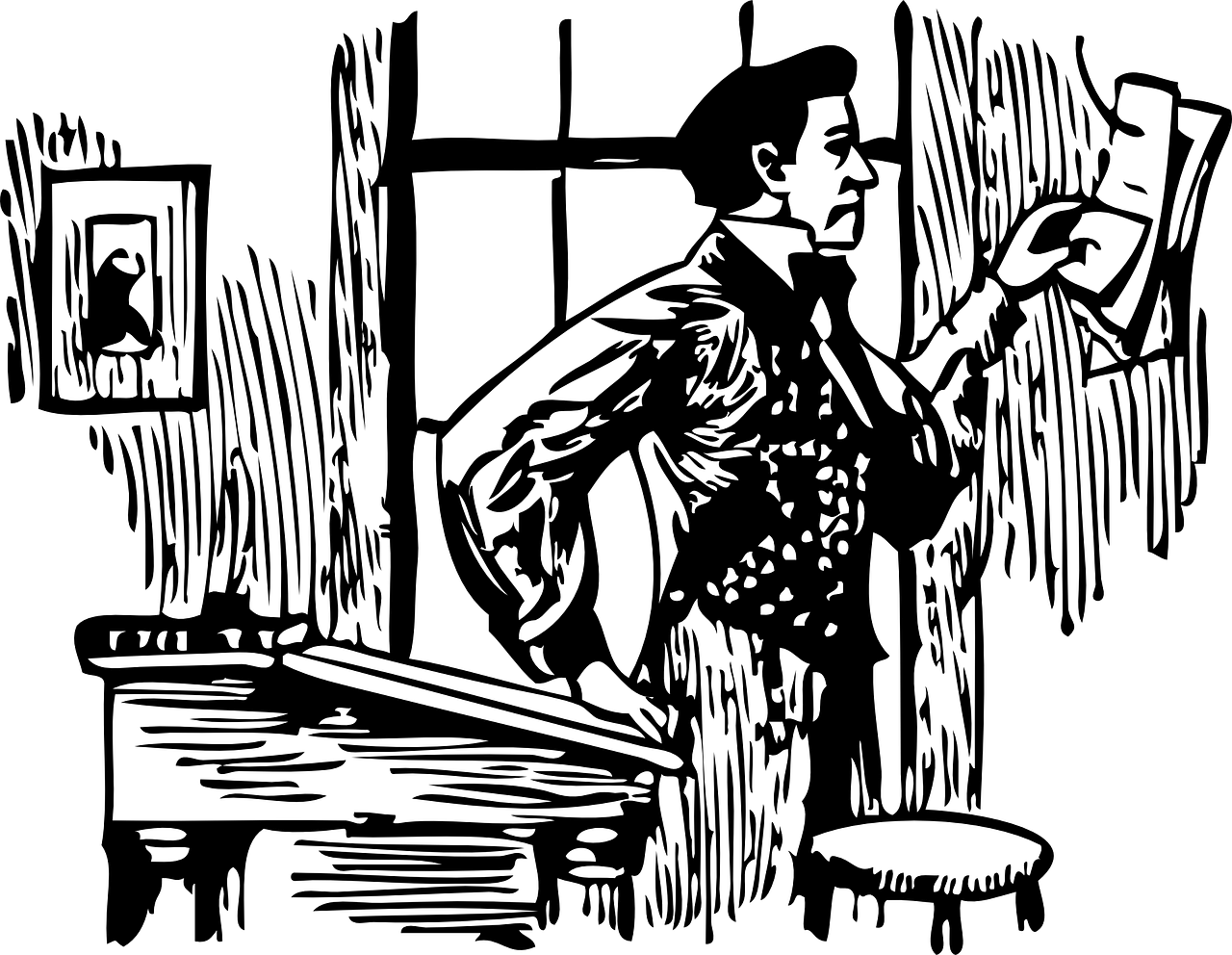
Keine nervigen Updates, kein langsames Hochfahren und keine hinderlichen Dialogboxen halten den schreibwilligen Autor, der gerade in einer ideengeladenen Ektase schwebt, davon ab, seine Ideen, seine Buchstaben, Wörter und Sätze festzuhalten. Nur bei der Mobilität gewinnt dann doch der Laptop: Selbst Reiseschreibmaschinen sind recht schwere Geräte, die nicht einfach bei einem Spaziergang im Wald mitgenommen werden können.
5. Die Geräusche
Es mag merkwürdig klingen, doch nicht wenige Autoren benutzen am Computer Programme, welche die Eigenheiten einer Schreibmaschine imitieren. Besonders wichtig für sie ist hierbei wohl die „audiovisuelle Wiedergabe“ des Geschriebenen, vor allem die mechanischen Geräusche beim Anschlagen einer Taste und das berühmte „Bing!“ beim Erreichen des
Seitenrands.
Dies sind nur einige der psychologischen Faktoren, die eine Rolle beim Schreibprozess spielen. Im Gesamtbild gleichen sich die Vor- und Nachteile beider Technologien vermutlich wieder aus, es bleibt wohl Geschmackssache.

Interessant aber immerhin: Etwa 25-30 Prozent (!) der Autoren verfassen ihr Manuskript auch heute noch mit der lieben alten Schreibmaschine!